Aufmerksam geworden bin ich auf „Das Hohe Lied“ durch diesen Beitrag, der mich sofort nach diesem Roman recherchieren ließ. Ja, das hörte sich genau nach meiner Wellenlänge an. Und so war es auch.
Nell Zink erzählt in „Das Hohe Lied“ von drei jungen Leuten, Pamela, Daniel und Joe, die sich in den 80ern in New York kennenlernen und beginnen, gemeinsam Musik zu machen. Sie sind große Punk-Fans, aber keine großen Musiker. Pam und Daniel verlieben sich ineinander, Pamela wird schwanger. Sie beschließen, ungeachtet ihrer Jugend und des Geldmangels, Flora zu bekommen.
Pamela ist von zu Hause abgehauen, braucht also Geld, und wird trotz mangelnden High-School-Abschlusses Programmiererin in einer kleinen Firma. Die 90er bringen ein gutes Einkommen für gute Spezialisten. Daniel arbeitet in einer Zeitarbeitsfirma. Sie wohnen in einem illegalen, abbruchreifen Loft, das sie zeit ihres Lebens begleiten wird. Sie sind zufrieden mit ihrer Situation, nehmen die Welt, wie sie sich ihnen bietet, streben nicht nach Materiellem. Daniel eröffnet ein kleines Label, und sie ziehen durch die Clubs, und schließlich geschieht ein kleines Wunder: eines von Joes Liedern entwickelt sich zu einem Hit.
Fortan lebt Joe zwei Leben: eines als Babysitter Floras, der er eine Welt jenseits der üblichen Denkmuster eröffnet, eines als Rockstar, in der er Drogen und falschen Freunden (in dem Fall einer sehr falschen Freundin) auf den Leim geht. Dennoch läuft alles gut für die drei, bis der 11. September alles ändert.
Daniel und Pam fahren mit Flora zu Pams Eltern nach Washington, die ihr von nun an ein geregeltes, gesichertes Leben bieten. Flora, nun geerdet, mit einer guten Ausbildung, wächst in der Social-Media-Generation heran, mit allen Höhen, Tiefen und Chancen, die diese zu bieten haben. Sie engagiert sich in der Green Party, einer Partei, die neben den demokratischen und konservativen Riesen eine nur minimale Rolle spielt, die aber den Optimismus ihrer Generation spiegelt, der mit dem Wahlkampf Trumps und allem, was danach folgt, einen herben Rückschlag erleidet. Und nicht nur hier wird Floras Unsicherheit gespiegelt, auch in einer sehr persönlichen Frage muss sie sich entscheiden. Können ihr die Personen in ihrem Leben, die unterschiedlicher nicht sein könnten, helfen?
Nell Zink hat mit „Das Hohe Lied“ den Zeitgeist genau getroffen. Kurz vor der historischen Wahl, die mehr als jede zuvor zwei so unterschiedliche Richtungen vorgibt, schreibt sie über die Illusionslosigkeit und die Ich-bin-dagegen-Mentalität der 80er Jahre und leitet bis zur Wer-am-lautesten-brüllt-hat-Recht-Mentalität der Gegenwart. Ganz nebenbei führt sie den Leser durch die Ereignisse der letzten 40 Jahre, von der Untergrundbewegung der 80er und das Aufkommen des Grunge über die Bankenkrise bis hin zur Wahl des Mannes ohne Gewissen.
Sie zeigt Mainstream-Culture ebenso wie Subkulturen, Individualität vs. Angepasstheit, Sich-Arrangieren und Aufbegehren. „Das hohe Lied“ ist ein Roman über unterschiedliche Lebensentwürfe, dem (Weiter)Leben mit Verlusten und dem Festhalten an Hoffnung. Es ist ein unbedingt zu empfehlendes Stück Zeitgeschichte und passt perfekt in diese merkwürdige Zeit rund um die Wahlen am 3. November und allem, was dann folgen mag. Und nicht zuletzt ist es ein Roman mit glaubhaften Figuren, die man schnell ins Herz schließt und deren Schicksal man unbedingt verfolgen möchte.
Nell Zink: Das Hohe Lied. Aus dem Englischen von Tobias Schnettler. Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg 2020. OA: Doxology. Ecco Press, Harper Collins, New York 2019. 509 Seiten.
Ich danke dem Rowohlt Verlag für das Rezensionsexemplar. Die Tatsache, dass es sich um ein Rezensionsexemplar handelt, hat meine Meinung in keiner Weise beeinflusst.
Eine weitere Besprechung gibt es bei literaturleuchtet.


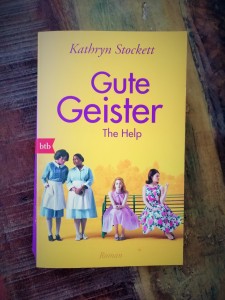







Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.