„Tja, so war dat alles gewesen, Pheoby, genau so, wie ich dir dat erzählt hab. Jetz bin ich also wieder zu Hause, un ich bin froh, dat ich hier bin. Ich bin bis nachen Horizont un wieder zurück, un jetz kann ich beruhigt hier in mein Haus leben un mich an meine eigne Erfahrungen halten.“ (273/274)
Dies sagt Janie Crawford zu ihrer Freundin Pheoby, als sie nach eineinhalb Jahren nach Hause zurück kommt und ihrer Freundin über diese Zeit Bericht erstattet hat. Doch nicht nur von dieser Zeit erzählt sie, sie berichtet von ihrem ganzen Leben und wie sie an dem Punkt angelangt ist, an dem sie sich jetzt befindet.
 Ihre Großmutter, die sie aufgezogen hat, erlebte noch die Sklaverei. Sie wollte ihre Enkelin sicher verheiratet und versorgt wissen, weswegen Janie mit sechzehn Logan Killicks heiratet, einen wesentlich älteren Mann, der eine eigene Farm besitzt und Janie ehrlich mag, aber nicht in der Lage ist, ihr dies zu zeigen. Janie ist unglücklich in dieser arrangierten Ehe, hat sie doch immer gehofft, dass die Liebe sich einstellen würde, wenn sie verheiratet sei, und sie muss einsehen, dass eine Ehe nicht automatisch Liebe mit sich bringt.
Ihre Großmutter, die sie aufgezogen hat, erlebte noch die Sklaverei. Sie wollte ihre Enkelin sicher verheiratet und versorgt wissen, weswegen Janie mit sechzehn Logan Killicks heiratet, einen wesentlich älteren Mann, der eine eigene Farm besitzt und Janie ehrlich mag, aber nicht in der Lage ist, ihr dies zu zeigen. Janie ist unglücklich in dieser arrangierten Ehe, hat sie doch immer gehofft, dass die Liebe sich einstellen würde, wenn sie verheiratet sei, und sie muss einsehen, dass eine Ehe nicht automatisch Liebe mit sich bringt.
Dann trifft sie eines Tages an ihrem Gartenzaun Joe Starks, der nach Eatonville will, eine Stadt, die von Schwarzen gegründet wurde und in der nur Schwarze leben. Sie treffen sich regelmäßig, Joe Starks ist von ihrer Anmut und ihrem besonderen Haar hingerissen, und er bietet ihr an, sie mitzunehmen und sie zu heiraten. Janie hofft, in Joe endlich die Liebe ihres Lebens zu finden, ebenso wie ein aufregenderes Leben als ihr die Farm jemals hätte bringen können, und so willigt sie ein.
Sie treffen als Ehepaar in Eatonville ein, und da sich niemand um die Belange der Stadt zu kümmern scheint, macht Joe sich zum Bürgermeister und leitet die Angelegenheiten fortan, ebenso wie seinen eigenen Laden, den jedoch mehr Janie führt. Und so wird Janie zur angesehensten Frau vor Ort, doch Joe ist eifersüchtig, und so muss sie ihr Haar verstecken und darf nicht mit den anderen reden. Sie leben sich auseinander, bis Joe eines Tages stirbt.
Janie, nun eine reiche Witwe, weiß nicht so recht, was sie mit ihrem Leben anfangen soll, ihre Träume hat sie begraben, und, obschon man ihr ihr Alter nicht ansieht, ist sie keine junge Frau mehr, der die Welt offensteht. Doch dann kommt eines Tages Tea Cake in ihren Laden, ein wesentlich jüngerer Mann, der von Janie hingerissen ist und sie fortan umwirbt. Sie hat mit den Konventionen zu kämpfen, dem Gerede, den schiefen Blicken. Doch Tea Cake gibt ihr etwas, das keiner vor ihm ihr geben konnte, und so trifft Janie eine Entscheidung…
„Ich weiß, die ganzen Tagediebe un Maulhelden drüben auf der Veranda, die wern fast platzen vor Neugier, datse endlich rauskriegen, von wat wir zwei beide am Reden warn. Soll mir recht sein, Pheoby, kannsdse ruich alles erzähln. Die wern sich wundern, weil meine Liebe nich so funktioniert hat wie ihre Liebe, wennse überhaupt welche erlebt ham. Dann muß duse erzähln, dat Liebe eem nich wien Mühlstein is, war rundrum gleich is un mit alles, wat er berührt, dat gleiche macht. Liebe is wie die See. Immer in Bewegung, un trotz alledem krichtse ihr Form von der Küste, wo se drauf trifft, bei jeder Küste wieder ne andre.“ (274)
Der Buchumschlag sagt, „Zora Neale Hurston erzählt […] in der Sprache der Veranda, in den dunklen Vokalen des Südens. Die Übersetzerin Barbara Henninges hat eine Sprache erfunden, die die Synkopen und Blue-notes des Slangs im Deutschen zum Klingen bringt“. Die Dialoge sind in diesem „Slang“ verfasst, in den man sich, wenn man sich erst einmal eingelesen hat, ein wenig verliebt, der Singsang entwickelt einen eigenen Sog und eine Intensität, die nicht so schnell loslässt. Die Textpassagen sind in „normalem Englisch“ verfasst, aber ich kann mir vorstellen, dass es nicht so leicht ist, diesen Roman im Original zu lesen und denke, die Übersetzerin hat hier einen außergewöhnlichen Job gemacht.
Aber lesen sollte man Und ihre Augen schauten Gott, von dem Alice Walker sagte: „Es gibt kein wichtigeres Buch für mich.“, auf jeden Fall. Dies ist eine Geschichte einer außergewöhnlichen Emanzipation, von der ich nicht gedacht hätte, dass sie in diesen Umständen überhaupt möglich sei. Die Sklaverei ist vorbei, doch ist Janie eine junge schwarze Frau in den zwanziger, dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts. Es bilden sich „schwarze Städte“, doch viele Menschen bleiben nach wie vor Wanderarbeiter. Jedoch geht von dem Roman insgesamt eine positive Aufbruchsstimmung aus, und die Wanderarbeiter wissen sich ihr Leben – unter den Umständen – doch gut zu gestalten.
Der Roman entstand 1937 und ist ein Klassiker der schwarzen Literatur Amerikas. Ich kann ihn unbedingt empfehlen, denn nicht nur die Geschichte, die erzählte wie auch die der Umstände, ist es wert, erlesen zu werden, auch sprachlich ist er sehr außergewöhnlich, etwas, das man nicht alle Tage findet.
Zora Neale Hurston: Und ihre Augen schauten Gott. Aus dem Amerikanischen übersetzt und mit einem Glossar versehen von Barbara Henninges. Ammann Verlag AG, Zürich, 1993. OA: Their Eyes Were Watching God. J.B.Lippincott, Inc., Philadelphia 1937.
Zora Neale Hurston wurde am 7. Januar 1891 in Alabama geboren. Sie wuchs in Eatonville, Florida, auf. Sie besuchte die Howard University in Washington, D.C. und lernte die Schriftsteller der Harlem Renaissance kennen, zu der auch sie gezählt wird. Ab 1927 sammelte sie in den Südstaaten Folklore, Geschichten, Lieder, Tänze und Gebete der schwarzen Bevölkerung, die sie vorstellte und verarbeitete. Sie gehörte in den 1930er Jahren zu den wichtigsten Autoren der afroamerikanischen Literatur. In den 50er Jahren war ihr Ruhm jedoch verblasst, sie starb in Armut an einem Herzleiden am 28. Januar 1960 in Fort Pierce, Florida.
1973 spürte Alice Walker das Grab von Hurston auf und begann mit dem Artikel „In Search of Zora Neale Hurston“ die Wiederentdeckung von Werk und Person.











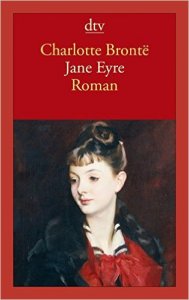



Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.